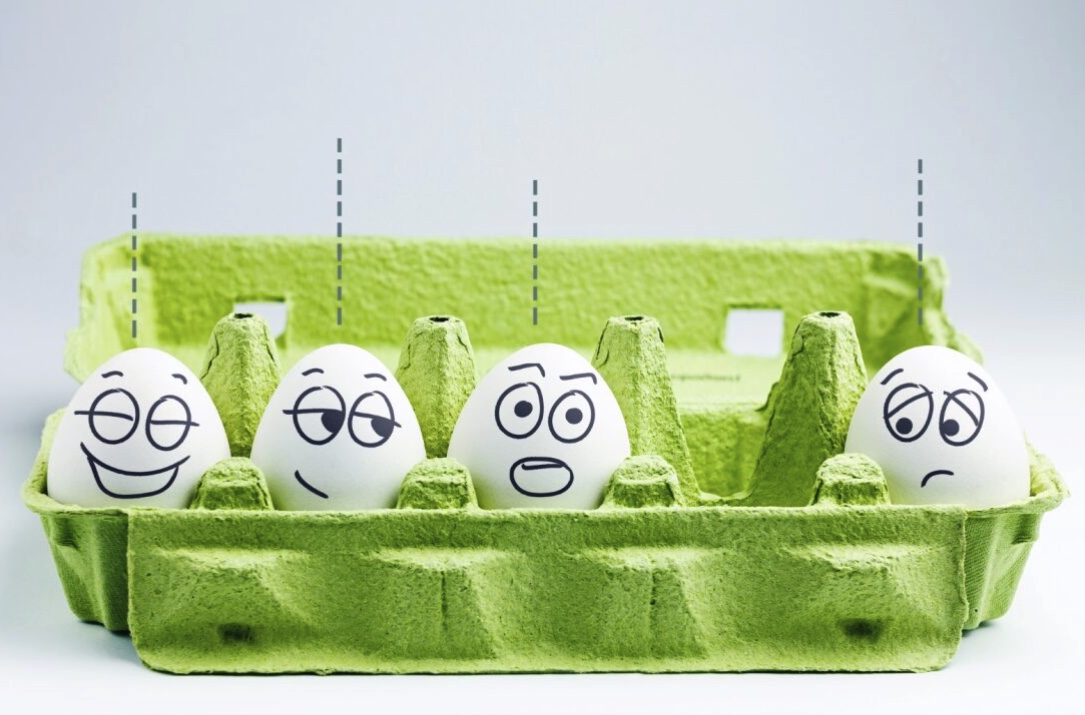Überwältigt von der «schwarzen Galle»
Facetten der Melancholie
TEXT: KLAUS DUFFNER
Schwermut, Melancholie und Depression sind keine Phänomene der Neuzeit, auch wenn ihnen – glücklicherweise – heute viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als in vergangenen Epochen. Gleichwohl haben sich schon sehr früh Gelehrte über die Traurigkeit Gedanken gemacht.
Auf den antiken Arzt Hippokrates geht die «Viersäftelehre» zurück, nach der der Körper aus vier «Säften» bestehe, nämlich Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Die Idee: Das Gleichgewicht dieser Säfte ist für die Gesundheit entscheidend, ein Ungleichgewicht verursacht Krankheiten. Ein Überschuss an «schwarzer Galle» führt dabei neben speziellen körperlichen Erkrankungen (beispielsweise auf der Haut) auch zu verschiedenen Gemütszuständen und Nervenkrankheiten. Dazu gehören Niedergeschlagenheit, Trübsinn, Tobsucht, Epilepsie, Wahnsinn oder Demenz. Der Begriff Melancholie, der die beiden griechischen Wörter melas (schwarz) und cholan (schlecht gelaunt sein, aufbrausen, verrückt sein) verbindet, weist also auf eine insgesamt dunkle Gemütsverfassung hin.
Die schwarze Galle und die Melancholie wurden in der Antike jedoch nicht nur als schlecht angesehen. Theophrast (371 v. Chr. bis 287 v. Chr.), ein bedeutender Schüler von Aristoteles, betonte, dass die Melancholie eine Doppelgesichtigkeit habe, die sich einerseits als Krankheit zeige und andererseits als Voraussetzung für Genialität angesehen werde, beispielsweise in der Kunst.
«Ein Übermass der schwarzen Galle galt in der Antike als Quelle von Traurigkeit – und von Genialität.»
Körpersäfte bestimmen den Charakter
Im Mittelalter verliert der Aspekt des «Melancholikers als Genie» an Bedeutung. Vielmehr rücken Angstzustände, Wahnvorstellungen, Schlaflosigkeit, Trägheit, Müdigkeit, Abmagerung und Völlerei, Störung der Potenz, ständiges Grübeln, Verfolgungswahn, Persönlichkeitsstörungen, Verzweiflung und Selbsthass in den Vordergrund. Die krankhafte Melancholie im Mittelalter ähnelt daher mehr dem modernen Bild einer psychosomatischen Krankheit. Man wird «überfallen» von einem unerklärbaren Übel und einem die Seele beherrschenden Argwohn, aus dem Furcht und Traurigkeit entstehen. Aber immer noch glauben mittelalterliche Gelehrte an das Übermass der «schwarzen Galle», die sich auf Herz und Gehirn ausbreite.
Auch die im Mittelalter ausführlich beschriebene «Liebeskrankheit» ist (ebenso wie der Liebeskummer heute) eng mit der Melancholie verbunden. Sie entsteht hauptsächlich durch nicht erwiderte und daher unerfüllbare Liebe und äussert sich in Schlaflosigkeit, anhaltender Traurigkeit, Appetitlosigkeit und Stimmungsschwankungen bis hin zu paranoiden Schüben.
Im 12. und 13. Jahrhundert hatte überdies die Temperamentenlehre ihren Höhepunkt. Danach war die Melancholie nicht mehr nur eine krankhafte Pathologie, sondern eine gottgegebene Charaktereigenschaft. Das Vorherrschen einer der vier Körpersäfte bestimmte den Menschen in seinen charakterlichen Anlagen. Bei einer Dominanz des Bluts zählte man zum fröhlichen Typ, der gelben Galle zum cholerischen Typ, an Schleim zum phlegmatischen Typ und beim Vorherrschen der schwarzen Galle war man eben ein schwermütiger Typ. Eine besondere Form der Melancholie im Mittelalter war die als Mönchskrankheit bezeichnete Acedia. Sie äusserte sich als Widerwillen gegen Pflichterfüllung und als lähmende Schlaffheit zur Mittagszeit. Die Erschöpfungssymptome und Verkrampfungszustände konnten sich gemäss einer Schilderung von Thomas von Aquin dabei so extrem ausbilden, dass überhaupt keine körperliche Bewegung mehr möglich war, «der Mensch verharrt, als ob er blödsinnig geworden wäre».
Melancholisches Genie?
Mit der Auseinandersetzung der italienischen Humanisten mit antiken Autoren stellte sich in der Renaissance erneut die Frage nach dem melancholischen Genie. Die schwarze Galle wurde aus dem krankhaften Wahnsinn in den kreativen Bereich gehoben und wie schon in der Antike auf die Zweideutigkeit dieses dunklen Körpersafts fokussiert. Dabei war der Melancholiker mit dem tiefsinnigen Nachdenken eines gebildeten Menschen verbunden, was sich beispielsweise in der Lyrik und Literatur niederschlagen sollte. Die Vorstellung einer engen Verbindung zwischen Genie und Wahnsinn, wie sie bei den Griechen angelegt und in der Renaissance weiterentwickelt wurde, hat sich bis heute erhalten. Allerdings steht das «wahnsinnige Genie» nicht mehr spezifisch in Verbindung mit der Melancholie. Mit der Ausdifferenzierung psychiatrischer Krankheitsbilder seit dem beginnenden 20. Jahrhundert wurde die Melancholie von Persönlichkeitsstörungen und Schizophrenie abgegrenzt. Die Symptomatik melancholischer Erkrankungen findet sich heute im Krankheitsbild der Depression.
Quelle: Jansen, Daria Norma; Melancholie im Mittelalter. Eine antike Tradition als Vorentwurf der Moderne. 2017; Universität Tübingen
Bild: ©TanyaJoy/AdobeStock

Newsletter
Jetzt anmelden!